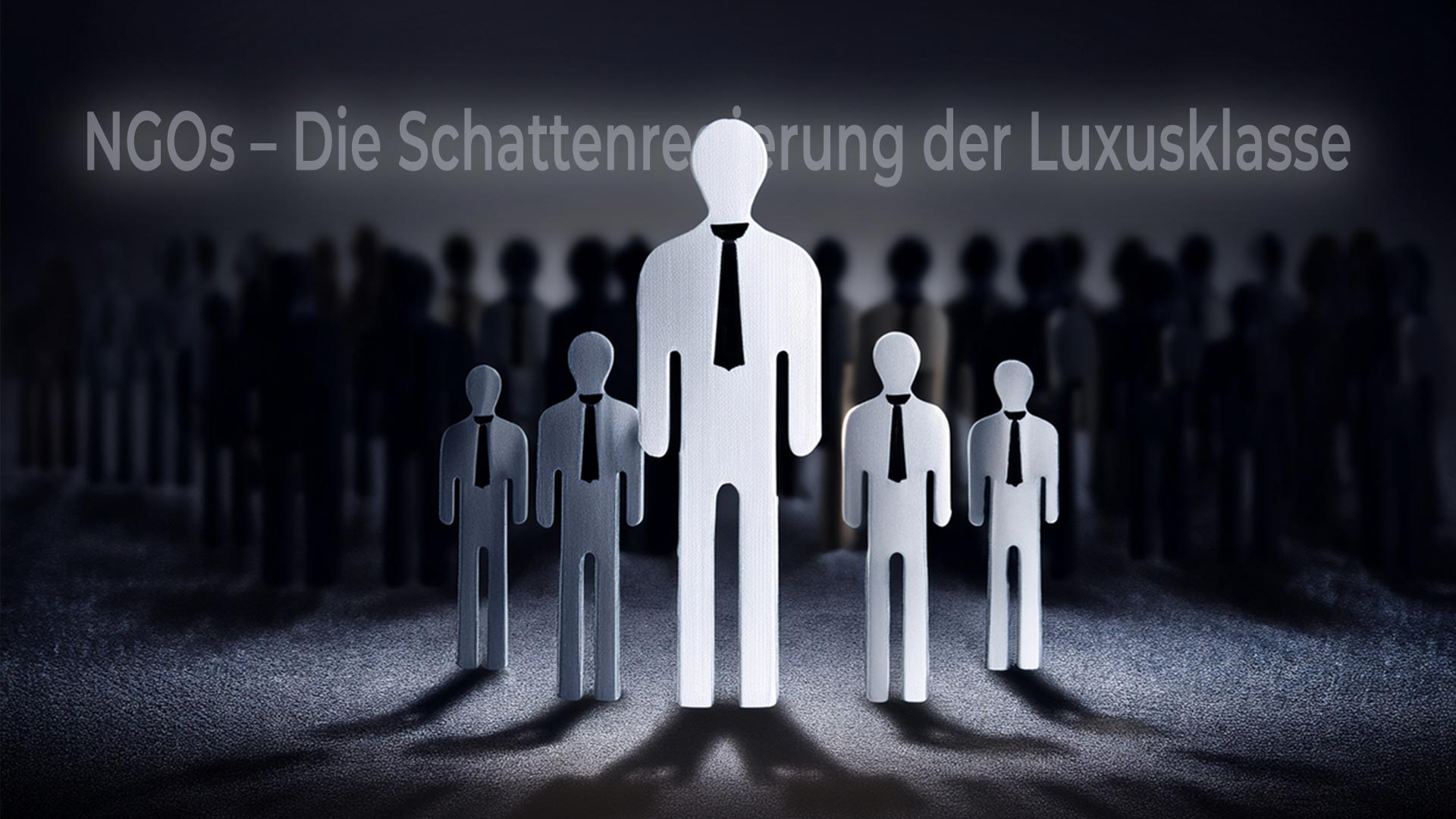Demokratie – das war einmal die Idee, dass der Souverän, also das Volk, am Ende tatsächlich selbst entscheidet. Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute reichen ein paar Dutzend gut vernetzte NGO-Kader, ein schicker Sitz in Zürich, Berlin oder Brüssel und das passende Spendenkonto, um ganze Gesetzesvorhaben auf den Kopf zu stellen – und das alles mit dem moralischen Überlegenheitsgefühl, auf „der richtigen Seite der Geschichte“ zu stehen.
Die moderne Politik ist bequem geworden. Regierungen, einst für ihre Handlungsfähigkeit und Standfestigkeit gewählt, lagern die kniffligen oder unpopulären Aufgaben elegant aus: NGOs, Stiftungen, Vereine und diverse „Bürgerinitiativen“ übernehmen den Job, den eigentlich das Parlament erledigen müsste – aber ohne demokratische Legitimation und ohne jede Rechenschaftspflicht. Und wenn der Souverän dann doch einmal querlegt? Kein Problem, dann bringt die Medienmacht der NGO-Netzwerke die öffentliche Meinung schon wieder auf Linie. Wer sich dem entgegenstellt, wird zum Hinterwäldler, Demokratiefeind oder gleich zum „Gefährder“ gestempelt.
Besonders im DACH-Raum, wo das Schweizer Milizsystem, der deutsche Föderalismus und der österreichische „Schmäh“ als Bollwerk gegen Machtmissbrauch gelten sollten, blüht das Outsourcing an NGOs wie ein besonders üppiger Alpengarten: Klima-Volksinitiativen, Gender-Kommissionen, Anti-Hass-Gesetze, allesamt befeuert, gefördert und finanziert von Organisationen, deren Mitglieder oft bequem in einem einzigen Sitzungszimmer Platz finden. Kein Wunder: Der Staat ist auf Kuschelkurs mit der Zivilgesellschaft – sofern diese zufällig die richtigen Themen besetzt.
Was diese demokratiepolitisch hochgefährliche Entwicklung für Folgen hat, welche Institute besonders auffällig agieren, und warum es höchste Zeit ist, der NGO-Demokratie endlich die Spendenschraube anzuziehen, zeigt dieser Artikel – satirisch, sarkastisch und garantiert politisch unkorrekt.
Demokratie auf Bestellung – Wenn 200 Mitglieder reichen
Die eigentliche Revolution hat längst stattgefunden: Während sich ganze Völker Jahrhunderte lang für ein bisschen Mitsprache abgerackert haben, reicht heute ein kleines Grüppchen mit gutem Netzwerk und Zugang zur richtigen PR-Agentur, um die Politik eines Landes zu steuern. Wer braucht schon Zehntausende Parteimitglieder, wenn ein Dutzend motivierter NGO-Profis im schicken Coworking-Space den Kurs für die gesamte Gesellschaft bestimmen kann?
Nehmen wir das Paradebeispiel „Greenpeace Schweiz“: Knapp 100‘000 Unterstützer auf dem Papier, doch die strategischen Entscheide fallen im Kreis einer Handvoll unbequemer Berufsaltruisten. Die Mitgliederstruktur bleibt nebulös, Neumitglieder werden in der Regel nie gefragt, ob und wie sie zu den jeweiligen Kampagnen stehen. Das Resultat: Die grosse Masse dient als moralische Kulisse, damit die Schlagzeilen noch besser wirken – und das Spendenvolumen schön sprudelt. Demokratie? Das ist hier eher ein Staffelfinale von „House of Cards“ auf Schweizerdeutsch.
In Deutschland sieht’s nicht besser aus. „Campact“ mit Sitz in Verden zählt laut Eigenwerbung Millionen Unterzeichner für Online-Petitionen, die inhaltlich meist nicht einmal die eigene Basis versteht. Mit ein paar cleveren Mailings und Social-Media-Kampagnen wird schon die gewünschte Unterschrift eingesammelt – und schon entsteht der Eindruck einer mächtigen Volksbewegung. Wer will da noch fragen, ob das Volk überhaupt weiss, was in seinem Namen gefordert wird?
Wer nach demokratischer Kontrolle sucht, wird schnell feststellen: Die eigentlichen Entscheidungen treffen kleine Zirkeln – mit erstaunlicher politischer Durchschlagskraft. Ob in Bern, Berlin oder Brüssel: Die NGOs sind längst die besseren Parteien. Sie müssen nicht gewählt werden, sie erklären sich einfach selbst zur moralischen Avantgarde.
⚠️ Infobox: Greenpeace Schweiz
Name: Greenpeace Schweiz
National/International: Nationaler Ableger der internationalen Greenpeace-Organisation, aktiv in der ganzen Schweiz
Sitz: Zürich
Struktur: Verein mit wenigen Dutzend Angestellten, Führungsteam und einigen tausend aktiven Unterstützern; Entscheidungen zentral durch Vorstand und Kampagnenleitung
Finanzierung: Hauptsächlich private Spenden; Transparenz bei Grossspenden ausbaufähig, Beteiligung internationaler Fonds
Aktivitäten: Politische Kampagnen zu Umwelt-, Klima- und Energiefragen; regelmässige Einflussnahme auf Abstimmungen durch medienwirksame Aktionen
Kooperationen: Vernetzt mit anderen internationalen NGOs (WWF, Pro Natura), Kooperationen mit Parteien und Aktivistengruppen bei Volksinitiativen und Referenden
⚠️ Infobox: Campact e. V.
Name: Campact e. V.
National/International: National (Deutschland), zunehmend mit EU-Kampagnen
Sitz: Verden (Deutschland)
Struktur: Verein mit weniger als 100 Angestellten, Millionen „digitale Unterstützer“ (Mailingliste)
Finanzierung: Spenden, Mitgliedsbeiträge, Crowdfunding-Kampagnen; keine staatlichen Mittel, aber undurchsichtige Fördergelder aus internationalen Netzwerken
Aktivitäten: Online-Petitionen, Organisation von Demonstrationen und Kampagnen zu Klima, Migration, Landwirtschaft, Demokratie
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Avaaz, Attac, BUND und anderen linken Initiativen; strategische Partnerschaften mit Medien und Politikern
Noch Fragen zur demokratischen Legitimation? Hier entscheidet, wer am lautesten auf den Spenden-Button drückt – und nicht, wer gewählt wurde.
Spendenparadies oder Geldwaschanlage?
Wer glaubt, NGOs seien der letzte Hort von Idealismus und freiwilliger Bürgerbeteiligung, sollte dringend einen Blick auf die Geldflüsse werfen. Denn hinter den bunten Spendenaufrufen und tränenreichen Imagekampagnen verbirgt sich oft ein System, das in Sachen Intransparenz so manchem Offshore-Finanzjongleur Ehre machen würde. Die Kunst ist einfach: Man schiebt sich die Millionen gegenseitig zu, vorzugsweise über Stiftungen, „Fördervereine“ oder gleich einen neuen Dachverband, und nennt das Ganze dann „zivilgesellschaftliches Engagement“.
Besonders beliebt: Die berühmte Open Society Foundations – offiziell für Demokratie und Menschenrechte, inoffiziell der grösste Geldautomat für politische Bewegungen von San Francisco bis Sibirien. Wer zu den „richtigen“ Themen arbeitet, bekommt Geld. Und zwar nicht zu knapp. Kritiker? Werden als Verschwörungstheoretiker abgetan. Spendenquittung gibt’s trotzdem. Oder nehmen wir Sea Watch: Mit millionenschweren Spenden (und einem kräftigen Schuss Steuergeld) wird die halbe Mittelmeerflotte betrieben – und jeder, der kritisch nachfragt, wird gleich als Menschenfeind diffamiert.
In der Schweiz mischt Caritas kräftig mit: Offiziell „unabhängig“, de facto aber mit engsten Verbindungen zu Staat und Kirche. Spendenquellen? Irgendwo zwischen Sonntagskollekte und Subvention aus Bern, alles schön in der Buchhaltung verborgen – Hauptsache, die moralische Überlegenheit stimmt.
Wer als NGO gut vernetzt ist, lebt im Spendenparadies – und die nächste Millionenüberweisung kommt bestimmt, ganz egal, ob die Vereinsbasis überhaupt weiss, wofür das Geld ausgegeben wird.
⚠️ Infobox: Open Society Foundations
Name: Open Society Foundations (OSF)
National/International: International, Stiftungsnetzwerk in über 120 Ländern
Sitz: Hauptsitz in New York, zahlreiche Länderbüros (z. B. Berlin, Budapest)
Struktur: Stiftung mit Tausenden von Mitarbeitern, zahlreiche Unterstiftungen und Partnerorganisationen
Finanzierung: Ursprünglich hauptsächlich durch George Soros (über 32 Milliarden Dollar), dazu Gelder von weiteren Grossspendern und staatlichen Entwicklungsprogrammen
Aktivitäten: Förderung von NGOs und Medien, Finanzierung von Kampagnen zu Migration, Minderheitenrechten, Justiz, politische Einflussnahme weltweit
Kooperationen: Enge Zusammenarbeit mit Amnesty, Human Rights Watch, lokalen Aktivisten, Think-Tanks und Universitäten
⚠️ Infobox: Caritas Schweiz
Name: Caritas Schweiz
National/International: National (CH) mit internationaler Vernetzung
Sitz: Luzern
Struktur: Verein mit mehreren hundert Angestellten, Teil des weltweiten Caritas-Verbunds
Finanzierung: Spenden, Kollekten, grosse Summen aus staatlichen Förderprogrammen und Lotteriefonds, EU-Projektgelder
Aktivitäten: Armutsbekämpfung, Integration, Kampagnen zu Sozial- und Migrationspolitik, offene politische Einflussnahme bei Abstimmungen
Kooperationen: Kooperationen mit Bundesämtern, Staatssekretariat für Migration, zahlreichen lokalen und internationalen NGOs
So einfach ist das: Wer genug Spendengelder einsammelt und die richtigen Kontakte pflegt, kann sich fast jede politische Kampagne leisten – Transparenz? Wozu, wenn Moral genügt!
Staatsaufträge outgesourct – von Klima bis Gender
Wer glaubt, dass der Staat sich wirklich aus Debatten heraushält, sollte einen Blick in die Vergabepraxis der letzten Jahre werfen: Alles, was politisch heikel, aber angeblich gesellschaftlich „wünschbar“ ist, wird längst an NGOs, Vereine oder Stiftungen ausgelagert. Der Trick ist einfach: Was die Verwaltung aus rechtlichen oder demokratischen Gründen nicht darf, erledigt die NGO um die Ecke. So kann sich die Regierung elegant die Hände waschen, und bei Kritik wird sofort die Debatte „unabhängige Zivilgesellschaft“ ins Feld geführt.
In Deutschland übernehmen Organisationen wie Pro Asyl oder Brot für die Welt längst Aufgaben, die eigentlich in den Zuständigkeitsbereich von Ministerien fallen. Von Beratungsstellen bis zu PR-Kampagnen – bezahlt wird oft direkt oder indirekt aus Steuergeldern. Die öffentliche Hand tritt als Grosskunde auf, während die NGOs als neutrale Instanzen inszeniert werden.
In der Schweiz dasselbe Muster: Wer eine Volksabstimmung gewinnen will, gibt den Auftrag für die mediale Kampagne kurzerhand an einen Verein wie Operation Libero oder Pro Mente Sana weiter. Natürlich nicht offiziell, sondern über diskrete Förderbeiträge, „wissenschaftliche Studien“ oder sogenannte Sensibilisierungsprojekte. Auf dem Papier alles unabhängig – in Wirklichkeit ein politisches Subunternehmertum erster Güte.
So wird demokratische Kontrolle zur Farce: Die Regierung bestellt, die NGO liefert – und das Volk darf zuschauen.⚠️ Infobox: Pro Asyl
Name: Pro Asyl
National/International: National (Deutschland) mit europaweiter Vernetzung
Sitz: Frankfurt am Main
Struktur: Verein mit mehreren Dutzend Angestellten und weit verzweigtem Unterstützernetz
Finanzierung: Spenden, Mitgliedsbeiträge, erhebliche Mittel aus staatlichen Förderprogrammen und Stiftungen
Aktivitäten: Beratung von Asylsuchenden, Lobbyarbeit, politische Kampagnen und Medienarbeit zu Asyl- und Migrationspolitik
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Caritas, Diakonie, Amnesty, diversen Anwalts- und Aktivistengruppen
⚠️ Infobox: Operation Libero
Name: Operation Libero
National/International: National (Schweiz), Fokus auf gesamtschweizerische Abstimmungen
Sitz: Zürich
Struktur: Verein, geführt von jungem Vorstand und Kernteam, stark digital vernetzt
Finanzierung: Spenden, Crowdfunding, Unterstützung durch Stiftungen und gelegentliche Beiträge von politischen Akteuren
Aktivitäten: Politische Kampagnen zu Abstimmungen (z. B. gegen Begrenzungsinitiative, für Gleichstellung), Social-Media-Kampagnen, Medienarbeit
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Parteien, Medien, anderen progressiven NGOs und internationalen Kampagnenplattformen
Ob Klima, Migration oder Gender – die politische Agenda wird heute ausgelagert. Hauptsache, das Etikett stimmt: „Unabhängig“, „zivilgesellschaftlich“, „progressiv“. Und am Ende zahlt der Steuerzahler doppelt – für den Auftrag und die spätere Kampagne.
Die gekaufte Volksmeinung – PR-Kampagnen statt Argumente
In der idealen Demokratie wird um Argumente gerungen. In der real existierenden NGO-Demokratie reicht ein prall gefülltes Kampagnenkonto – und schon läuft die Empörungsmaschinerie wie geschmiert. Ob Online-Petition, Hashtag-Kampagne oder bezahlte Anzeigenflut: NGOs und politisch getriebene Vereine wissen längst, wie man die öffentliche Meinung in die gewünschte Richtung schiebt. Die Medien spielen brav mit, schliesslich werden sie mit exklusiven Studien, Testimonials und dramatischen Schicksalen gefüttert.
Ein Paradebeispiel ist Campact: Mit professionellen Kampagnenmanagern und cleveren Social-Media-Strategien wird jede noch so absurde Forderung zur „Stimme des Volkes“ hochgejazzt – millionenfach geteilt, von Journalisten bereitwillig kolportiert und von der Politik als Handlungsauftrag aufgenommen. Die Grenze zwischen Bürgerbewegung und Werbeagentur ist längst verwischt.
Konkret zeigte sich das 2024 an der von Campact verbreiteten Deportations-Lüge zur „Wannseekonferenz in der Potsdamer Villa Adlon“: Obwohl jeder Historiker wusste, dass es die Villa Adlon und den genannten Vorgang so nie gab, wurde die Falschbehauptung von Campact in Windeseile über Social Media verbreitet – und von sämtlichen grossen System-Medien ungeprüft weitergetragen. Nach dem Motto: Lüge gross genug, dann wird sie geglaubt.
In der Schweiz machen Gruppen wie Pro Natura oder der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) vor, wie es geht: Teure Medienkampagnen, plakativer Populismus und unzählige Gutachten, alle bestens orchestriert und mit ordentlich Spendengeldern finanziert. Wer am lautesten trommelt, hat Recht – oder wenigstens die beste Medienpräsenz.
So wird Meinung gemacht: Mit genügend Geld und dem richtigen Netzwerk verwandeln sich selbst abseitige Forderungen in „Mehrheitsmeinung“. Am Ende applaudieren die Medien, und die Politik nimmt die Bestellung entgegen.
⚠️ Infobox: Campact e. V.
Name: Campact e. V.
National/International: National (Deutschland), zunehmend mit EU-Kampagnen
Sitz: Verden (Deutschland)
Struktur: Verein mit wenigen Angestellten, aber Millionen „Unterstützer“ auf Mailinglisten
Finanzierung: Spenden, Crowdfunding, Fördergelder von Stiftungen und Netzwerken
Aktivitäten: Online-Petitionen, Organisation von Demonstrationen, bezahlte Werbekampagnen zu Klima, Soziales, Demokratie
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Avaaz, BUND, Attac, zahlreichen Medienpartnern
⚠️ Infobox: Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)
Name: Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)
National/International: National (Schweiz), mit Verbindungen zu europäischen Umweltverbänden
Sitz: Bern
Struktur: Verein mit mehreren hunderttausend Mitgliedern, professionelles Management
Finanzierung: Mitgliederbeiträge, Spenden, staatliche Förderungen für Projekte, Lotteriefonds
Aktivitäten: Politische Kampagnen zu Verkehr, Klima, „sanfte Mobilität“; regelmässige Initiativen und Referenden
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Pro Natura, WWF, lokalen Verkehrsinitiativen, Parteien und Medien
Wer hier noch von „demokratischer Willensbildung“ spricht, hat die letzte Medienkampagne verschlafen – oder arbeitet bereits an der nächsten.
Referenden, Klagen, Medienpräsenz – Demokratie zum Sonderpreis
Wer meint, Politik sei noch eine Frage von Mehrheiten, der sollte mal einen Blick in die aktuellen Gerichtssäle, Medienarchive und NGO-Strategiepapiere werfen. Längst haben professionelle NGO-Lobbyisten erkannt, dass der direkteste Weg zur politischen Macht nicht über mühselige Wahlen oder Partei-Mitgliedschaften führt, sondern über das gekonnte Spiel mit Klagen, Referenden und Dauerpräsenz in den Medien. Das Rezept: Man schaffe einen Verein, der mit hehren Zielen auftritt, mobilisiere ein paar juristische Profis, sichere sich stabile Einnahmequellen – und schon lässt sich die Republik nach Belieben aufmischen.
Ein Paradebeispiel dafür ist die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Kaum eine deutsche Kommune, die nicht schon mit einer DUH-Klage konfrontiert wurde – und das oft wegen Bagatellen, die jeder normale Bürger gar nicht bemerken würde. Hinter vorgehaltener Hand geben selbst Politiker zu, dass man gegen diesen juristischen Dauerregen kaum noch ankommt. Und während der Ruf nach «mehr direkter Demokratie» in Sonntagsreden ertönt, reicht bei der DUH oft das grüne Telefonbuch: Ein paar Anwälte, ein aktuelles Feinstaubmessgerät und der nächste Prozess ist garantiert. Mitfinanziert wird der Spass von Industrieabgaben (man lese und staune, das ist kein Witz!), klassischen Spenden und «Erfolgshonoraren» aus abgeschlossenen Verfahren. Wer hier immer noch an das Bild des armen, kämpfenden Weltverbesserers glaubt, kann sich gleich ein Abo für den DUH-Newsletter zulegen.
In der Schweiz läuft es nach demselben Prinzip. Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) sowie Pro Natura haben sich als Musterbeispiele für das NGO-Prozess-Business etabliert. Neue Strasse geplant? Sofort flattert eine Einsprache ins Gemeindehaus, gleich garniert mit einer PR-Kampagne und juristisch sauber vorbereiteten Argumenten. Es reicht ein kleiner Expertenkreis, um ganze Infrastrukturprojekte für Jahre auf Eis zu legen – finanziert von Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Lotteriefonds und, wenn es in das Narrativ der Regierung passt, ein paar staatlichen Förderfranken. Die eigentliche Innovation: Das Referendum kommt gleich im Doppelpack mit. Ein Klick auf die NGO-Webseite genügt, schon kann jede Privatperson – bequem von zuhause aus – die Unterschrift unter die nächste Sammelaktion setzen. Wer glaubt, hier handle es sich noch um klassische «Volksbewegungen», wird schnell eines Besseren belehrt: In vielen Fällen stammen über die Hälfte der Unterschriften aus denselben Filterblasen, in denen auch die PR-Kampagnen gezündet werden.
Österreich bildet da keine Ausnahme. GLOBAL 2000 etwa mischt mit beachtlicher Professionalität mit – von der strategisch geplanten Verfassungsklage gegen neue Infrastrukturprojekte bis hin zur Medienoffensive gegen «umweltfeindliche» Politik. Im Hintergrund agieren ein festes Kernteam und erfahrene Juristen, die genau wissen, welche Rechtslücken und Aufmerksamkeitszyklen ausgenutzt werden können. Das Ziel ist immer gleich: Blockieren, verzögern, umdeuten – notfalls bis das Thema aus den Schlagzeilen verschwindet oder ein Zugeständnis erreicht ist. Die Finanzierung? Ein Mix aus Spenden, Fördergeldern der EU, nationalen Umwelt-Töpfen und cleveren Medienpartnerschaften. Was früher einmal als Graswurzelbewegung begann, ist heute ein Netzwerk mit direktem Draht in die Gesetzgebung.
Die Medienpräsenz dieser NGOs ist kein Zufall, sondern knallhart kalkuliert. Ob Live-Schaltung von der Protestaktion, emotionale Erfahrungsberichte «betroffener Bürger» oder regelmässige Talkshow-Einladungen für NGO-Sprecher – mit gut vorbereiteten PR-Teams wird jede juristische Eskalation begleitet und ins gewünschte Framing gegossen. Kritische Stimmen werden als «rechts», «ewiggestrig» oder «Lobbyisten der Konzerne» diffamiert, damit sich ja niemand mehr traut, die neue NGO-Republik in Frage zu stellen.
Fazit: Wer das nötige Kleingeld und ein juristisch geschultes Kernteam hat, braucht keine demokratische Mehrheit mehr – der Gang zum (weisungsgebundenen) Bundesgericht reicht. So wird Politik gemacht, ganz ohne lästige Wahlen, aber mit maximaler Empörung und dem Segen der wohlmeinenden Medienlandschaft.
⚠️ Infobox: Deutsche Umwelthilfe (DUH)
Name: Deutsche Umwelthilfe e. V.
National/International: National (Deutschland), mit Einfluss auf europäische Umweltpolitik
Sitz: Radolfzell am Bodensee, Berlin
Struktur: Verein mit rund 120 Mitarbeitenden, Führung durch langjährige Geschäftsführung
Finanzierung: Abmahngebühren von Industrie und Handel, Spenden, staatliche Projektförderung, Prozesskostenhilfe
Aktivitäten: Massenklagen gegen Autohersteller, Städte, Energieversorger; Organisation von Kampagnen und Medienarbeit
Kooperationen: Zusammenarbeit mit BUND, NABU, europäischen Umweltverbänden, Unterstützung durch Medien und einzelne Parteien
⚠️ Infobox: Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)
Name: Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)
National/International: National (Schweiz), auch mit Einfluss in europäischen Netzwerken
Sitz: Bern
Struktur: Verein mit mehreren hunderttausend Mitgliedern, professionelles Management
Finanzierung: Mitgliederbeiträge, Spenden, staatliche Förderungen, Lotteriefonds
Aktivitäten: Einsprachen und Beschwerden gegen Bauprojekte, Referenden zu Mobilität, Klimathemen, Begleitung politischer Prozesse
Kooperationen: Pro Natura, WWF, Zusammenarbeit mit Grünen, Medien, lokalen Initiativen
⚠️ Infobox: GLOBAL 2000
Name: GLOBAL 2000
National/International: National (Österreich), Mitglied im internationalen Friends-of-the-Earth-Netzwerk
Sitz: Wien
Struktur: Verein mit kleinem Führungsteam, Dutzenden Mitarbeitenden und ehrenamtlichen Unterstützern
Finanzierung: Spenden, Fördergelder von EU, nationale Umweltförderungen, Projektmittel
Aktivitäten: Verfassungsklagen, Referenden, Kampagnen zu Atomkraft, Pestiziden, Infrastrukturprojekten
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Friends of the Earth, BUND, Medien, lokalen Umweltgruppen
Das Resultat: Wer ein paar Profis und das nötige Kleingeld hat, kann heute Politik machen – nicht gewählt, aber bestens vernetzt und ständig auf Sendung.
Moral gegen Mehrheitswille – Wer entscheidet eigentlich noch?
Früher galt: Der Souverän ist das Volk. Heute heisst es: Der Souverän ist, wer das beste Moralmarketing betreibt. Die neue NGO-Elite hat ein sicheres Gespür dafür, wo man politische Mehrheiten aushebeln und den eigenen Willen als „alternativlose Menschlichkeit“ verkaufen kann. Die Masche funktioniert einfach und zuverlässig: Wer widerspricht, steht als Feind der Demokratie, Menschenrechte oder gar des Weltfriedens da. Wer mitmacht, darf sich als „Teil der Lösung“ feiern – ganz ohne Wahlkampf, Programme oder Mandat.
Nehmen wir etwa Fridays for Future: Eine lose organisierte Bewegung, die längst von millionenschweren Förderern, NGOs und parteinahen Thinktanks am Leben gehalten wird. Was als Schülerstreik begann, ist heute zur moralischen Speerspitze in der Klimapolitik geworden – mit direktem Zugang zu Medienhäusern, Politikerbüros und den PR-Abteilungen internationaler Konzerne. Gegenargumente? Zwecklos. Wer einen offenen Diskurs wagt, ist automatisch Klimaleugner oder Rechter.
In der Schweiz sind es Organisationen wie Omas gegen Rechts oder Allianz Gleichwürdig Mensch. Letztere gibt sich als unabhängige Menschenrechtsbewegung, organisiert aber professionell gesteuerte Kampagnen, PR-Events und Gesetzesinitiativen gegen alles, was nicht in den NGO-Mainstream passt. Wer sich kritisch zu deren Aktionen äussert, wird medial „gecancelt“ – und landet schneller auf den Listen der „Hassrede“-Beobachter, als einem lieb ist.
International zieht Amnesty International dieselbe Nummer ab: Mit globalen Kampagnen und Berichten, die immer dann zur Stelle sind, wenn die politische Wetterlage den Spin braucht. Kritische Stimmen werden als Feinde der Menschenrechte gebrandmarkt, egal ob es um Asyl, Klima, Gender oder vermeintliche Diskriminierung geht. Auch hier wird Moral zum politischen Hebel und zur Waffe gegen den Mehrheitswillen.
Was all diese Beispiele eint: Die Macht der moralischen Erzählung. Wer sie besitzt, kann Mehrheiten kippen, Debatten verhindern und sogar Volksabstimmungen im Nachgang delegitimieren. Die Medien helfen bereitwillig – schliesslich sind NGO-Kampagnen meist professioneller produziert als alles, was Parteien aufbieten.
Ergebnis: Demokratie ist heute oft nur noch die Kulisse, auf der NGOs mit ihrem Moral-Branding bestimmen, was als „gute Gesellschaft“ gilt – und wer draussen bleibt.
⚠️ Infobox: Fridays for Future (FFF)
Name: Fridays for Future
National/International: International, mit nationalen Ablegern (Deutschland, Schweiz, Österreich etc.)
Sitz: Kein offizieller Hauptsitz, Koordination über digitale Plattformen
Struktur: Lose Bewegung, aber mit Anbindung an NGOs und parteinahe Organisationen, professionelle PR-Unterstützung
Finanzierung: Spenden, Fördermittel von NGOs, Unterstützung durch Parteien, Thinktanks und Stiftungen
Aktivitäten: Klimastreiks, politische Kampagnen, Lobbyarbeit, Medienpräsenz
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Greenpeace, WWF, Campact, lokalen und internationalen Klimagruppen
⚠️ Infobox: Omas gegen Rechts / Allianz Gleichwürdig Mensch
Name: Omas gegen Rechts / Allianz Gleichwürdig Mensch
National/International: National (Schweiz, Österreich, Deutschland)
Sitz: Lokale Gruppen, lose Vernetzung, Hauptkoordination digital
Struktur: Vereine und lose Bündnisse, Leitung durch Sprecherinnen und PR-Teams
Finanzierung: Spenden, Fördergelder von Stiftungen, politische Unterstützer
Aktivitäten: Proteste, Kampagnen gegen „rechte“ Politik, Veranstaltungen, Medienarbeit, Einfluss auf Abstimmungen
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Parteien (v. a. links), NGOs, Medienhäusern, sozialen Bewegungen
⚠️ Infobox: Amnesty International
Name: Amnesty International
National/International: International, zahlreiche Landesgruppen und nationale Büros
Sitz: London (Hauptsitz), Länderbüros weltweit
Struktur: Internationales Netzwerk, nationale Sektionen, professionelles Management
Finanzierung: Spenden, Mitgliedsbeiträge, Förderungen von Stiftungen, gelegentlich staatliche Mittel
Aktivitäten: Menschenrechtsberichte, globale Kampagnen, politische Lobbyarbeit, Einflussnahme auf Gesetze und Medien
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Open Society Foundations, Human Rights Watch, zahlreichen nationalen NGOs, Parteien, Medien
Das Ergebnis: Die Mehrheit darf noch wählen – aber entscheiden tun andere. Willkommen im Zeitalter der NGO-Moral-Demokratie, in der der moralische Zeigefinger mehr zählt als jede Urne. Wer da nicht mitmacht, landet schneller auf der schwarzen Liste als auf einer Wahlliste.
Aktivismus als Geschäftsmodell – Karriere machen im Gutmenschentum
Wer meint, NGOs und politische Vereine seien ein Tummelplatz für Idealisten und Ehrenamtliche, hat die Jobbörsen und Gehaltslisten der Szene lange nicht mehr angeschaut. Aus dem Aktivisten mit selbstgemaltem Transparent wird binnen weniger Jahre der NGO-Manager mit Dienstlaptop, Medienberatung und 120‘000 Franken Jahresgehalt – mindestens. Während sich der einfache Spender mit dem Gefühl moralischer Überlegenheit zufriedengibt, winken an der NGO-Spitze Posten, Privilegien und nicht selten auch ein beachtliches persönliches Netzwerk.
Ein Beispiel: Greenpeace International. Wer es vom Schlauchboot zum Generalsekretär schafft, ist plötzlich Teil eines globalen Lobbynetzwerks, verkehrt bei den Vereinten Nationen und lässt sich von Medienkonzernen und Regierungen hofieren. Die Gehälter? Öffentlich nur ungern thematisiert, aber bei den Führungsetagen gerne im mittleren sechsstelligen Bereich. Fürs „gute Gewissen“ gibt’s noch ein nachhaltiges Dienstfahrrad obendrauf.
In der Schweiz zeigen Organisationen wie der WWF Schweiz oder die Stiftung für Konsumentenschutz, wie man mit „gemeinnützigen“ Strukturen nicht nur eine sichere Karriere, sondern auch Zugang zu den wichtigsten Entscheidungsträgern erhält. Der Aufstieg vom Aktivisten zum bezahlten Lobbyprofi erfolgt dabei erstaunlich schnell: Ein paar Jahre Engagement, ein Studienabschluss in Kommunikation oder Politikwissenschaft – und schon ruft die Geschäftsleitung. Nicht zu vergessen: die mediale Dauerpräsenz, als „Experte“ für alles zwischen CO₂, Ernährung und Gleichstellung.
Und dann wäre da noch das lukrative Spin-Off: Der Wechsel von der NGO in Politik oder Medien – oder umgekehrt. Das Personalkarussell zwischen Aktivismus, Parteien, Redaktionen und Lobbyagenturen ist beachtlich: Heute noch Kampagnenleiter, morgen schon politischer Berater oder Talkshow-Moderator. Die Grenzen verschwimmen, der Einfluss wächst.
Das Ergebnis: Wer das richtige Netzwerk und den richtigen Stallgeruch mitbringt, kann aus dem Geschäft mit der Weltrettung nicht nur eine Berufung, sondern ein sicheres Einkommen machen – mit Moralbonus und Applaus inklusive. Die Spender merken meist nicht einmal, wie ihr Idealismus das Geschäftsmodell anderer füttert.
⚠️ Infobox: Greenpeace International
Name: Greenpeace International
National/International: International, zahlreiche Landesverbände
Sitz: Amsterdam
Struktur: Dachverband, nationale Sektionen, Führung durch internationalen Vorstand und Generalsekretär
Finanzierung: Spenden, Mitgliedsbeiträge, Unterstützung durch Stiftungen, keine offiziellen Staatsgelder
Aktivitäten: Umweltkampagnen, internationale Lobbyarbeit, Protestaktionen, Einfluss auf globale Abkommen
Kooperationen: Zusammenarbeit mit UN-Organisationen, Regierungen, anderen grossen NGOs (WWF, Friends of the Earth, etc.)
⚠️ Infobox: WWF Schweiz
Name: WWF Schweiz
National/International: National (Schweiz), Teil des internationalen WWF-Netzwerks
Sitz: Zürich
Struktur: Stiftung mit Vorstand, Geschäftsleitung und mehreren hundert Mitarbeitenden
Finanzierung: Spenden, Mitgliederbeiträge, Projektförderungen von Bund und Kantonen, internationale WWF-Gelder
Aktivitäten: Umwelt- und Naturschutzprojekte, politische Kampagnen, Lobbyarbeit, Bildungsangebote
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Behörden, Schulen, Unternehmen, internationalen WWF-Organisationen
⚠️ Infobox: Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
Name: Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
National/International: National (Schweiz)
Sitz: Bern
Struktur: Stiftung mit Geschäftsleitung, Expertenrat und mehreren Dutzend Mitarbeitenden
Finanzierung: Spenden, Mitgliederbeiträge, Beiträge der öffentlichen Hand, Stiftungserträge
Aktivitäten: Konsumentenschutz, politische Kampagnen, Beratung, Medienarbeit, Einflussnahme auf Gesetzgebungsprozesse
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Behörden, Parteien, Medien, anderen Konsumentenschutzverbänden
Willkommen im neuen Traumberuf „NGO-Manager“. Hier wird Moral zu Geld gemacht – und der Applaus ist garantiert.
Internationale NGOs – Weltbürger ohne Bodenhaftung
Lokal reden, global handeln – so klingt das Motto vieler internationaler NGOs. In Wahrheit bedeutet es oft: Überall mitreden, aber nirgends Verantwortung übernehmen. Die grossen, weltweit vernetzten Organisationen haben sich längst zu einer eigenen Parallelgesellschaft entwickelt, die eigene Regeln aufstellt, ihre Budgets verschiebt wie es passt und sich höchstens an die medienwirksamsten Gesetzestexte erinnert. Nationale Interessen? Altmodischer Kram für Provinzpolitiker.
Nehmen wir zum Beispiel Amnesty International und Human Rights Watch: Wo immer auf der Welt eine neue Gesetzesvorlage diskutiert wird, tauchen schon die vorgefertigten Berichte, Pressemitteilungen und NGO-Vertreter auf. Unabhängig? Angeblich. Tatsächlich aber eng verzahnt mit westlichen Stiftungen, Regierungen und supranationalen Gremien wie der UNO oder der EU. Die Berichte werden medial als Wahrheit verkauft – die Folgen vor Ort müssen andere tragen.
In der Schweiz und Österreich ist das Muster gleich. Ärzte ohne Grenzen und die Open Society Foundations treten als scheinbar neutrale Hilfsorganisationen oder Förderer auf, pushen aber zugleich politische Programme, die bestens zu den Zielen ihrer Geldgeber und internationalen Partner passen. Ob Migrationsagenda, Gender-Quoten oder „neue Demokratien“ in Osteuropa – immer dabei: eine Armee von Projektmanagern mit PowerPoint und globalem Netzwerk.
Das Ergebnis: Globale NGOs spielen Weltregierung und geben vor, was als „gute Politik“ zu gelten hat. Wer widerspricht, ist provinziell, populistisch oder gar menschenfeindlich – so einfach geht Weltbürgertum ohne Bodenhaftung.
⚠️ Infobox: Amnesty International
Name: Amnesty International
National/International: International, mit Landesgruppen in über 70 Staaten
Sitz: London (Hauptsitz), zahlreiche Länderbüros
Struktur: Internationales Netzwerk, Landesbüros, professionelles Management
Finanzierung: Spenden, Mitgliedsbeiträge, Förderungen von Stiftungen, gelegentlich staatliche Mittel
Aktivitäten: Menschenrechtsberichte, globale Kampagnen, politische Lobbyarbeit, Einflussnahme auf nationale und internationale Gesetze
Kooperationen: Zusammenarbeit mit Open Society Foundations, UNO-Gremien, Regierungen, zahlreichen nationalen NGOs
⚠️ Infobox: Human Rights Watch
Name: Human Rights Watch (HRW)
National/International: International, mit Büros in über 40 Ländern
Sitz: New York
Struktur: NGO mit internationalen und regionalen Teams, Hauptquartier in den USA
Finanzierung: Spenden, Fördermittel grosser Stiftungen (insb. OSF/Soros), private Grossspender
Aktivitäten: Menschenrechtsberichte, internationale Lobbyarbeit, Kampagnen gegen nationale Regierungen, Einflussnahme auf Medien
Kooperationen: Open Society Foundations, UNO, Medienkonzerne, weitere internationale NGOs
⚠️ Infobox: Ärzte ohne Grenzen
Name: Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne Grenzen (MSF)
National/International: International, operativ in über 70 Ländern
Sitz: Genf, Paris, Brüssel (regionale Zentralen)
Struktur: Internationale NGO, nationale Vereine, hohe Mobilität und Vernetzung
Finanzierung: Spenden, Projektmittel von UNO, EU, gelegentlich staatliche Beiträge
Aktivitäten: Medizinische Hilfsprojekte, Notfallversorgung, aber auch Lobbyarbeit für globale Gesundheits- und Migrationspolitik
Kooperationen: UNO-Organisationen, nationale Gesundheitsministerien, andere internationale NGOs
Fazit: Wer heute als NGO das globale Sagen hat, muss keine Verantwortung mehr tragen – Hauptsache, die Agenda stimmt. Der Weltbürger sitzt im Jet, der Nationalstaat im Regionalzug – und Demokratie ist nur noch das Rahmenprogramm für internationale PR-Kampagnen.
Der NGO-Filz – Politik, Medien und Aktivisten im Drehtüreffekt
Wer glaubt, NGOs seien der Gegenpol zu etablierten Machtstrukturen, hat die Seitenwechsel der letzten Jahre nicht verfolgt. Der berühmte Drehtüreffekt sorgt dafür, dass aus dem NGO-Aktivisten ganz schnell ein Parlamentsabgeordneter wird – oder umgekehrt. Medien, Politik und NGOs vermischen sich in den Führungsetagen längst zu einem Filz, der für den Aussenstehenden kaum noch durchschaubar ist.
Da wechselt die Pressesprecherin von Greenpeace direkt in die Kommunikationsabteilung eines Bundesamts, ein ehemaliger WWF-Manager wird Chef einer Bundeskommission, und der Initiant einer Volksabstimmung steht ein Jahr später als Experte bei der „Tagesschau“. Besonders beliebt: Der Sprung vom Kampagnenleiter einer NGO zum parlamentarischen Berater oder gleich in den Stiftungsrat eines grossen Medienhauses. Kritische Nachfragen? Fehlanzeige – schliesslich kennt man sich seit Jahren von den gleichen Gremien, Podien und Afterwork-Events.
In der Schweiz läuft das Personalkarussell besonders effizient: Ob im Bundeshaus, bei grossen Medien oder in den Chefetagen der Umweltverbände – die Namen wiederholen sich. Aus der Umweltlobby wird die Klimakommission, aus der Anti-Diskriminierungs-Stiftung das nationale Forschungszentrum, und aus dem Parteisekretär der neue Direktor einer angeblich „unabhängigen“ NGO.
Auch im deutschen und österreichischen Raum ist die Vermischung von NGO, Medien und Politik Alltag: Wer das nötige Netzwerk mitbringt, kann innerhalb weniger Jahre alle Rollen einmal durchlaufen. Der Effekt: Gesetze werden von denselben Leuten erst im Namen der NGO eingefordert, dann als Abgeordneter beschlossen und später als Stiftungsbeirat in den Medien „erklärt“.
Am Ende bleibt eine hermetisch geschlossene Meinungs- und Machtblase, die sich nach aussen als Vielfalt verkauft, in Wirklichkeit aber auf eine Handvoll bestens vernetzter Akteure reduziert – und für jede Kritik den passenden PR-Berater parat hat.
⚠️ Infobox: Personalkarussell Schweiz – Beispiel
Name: (anonymisierte Darstellung, da Personalien wechseln regelmässig) Typisch: Wechsel zwischen NGO-Führung (z. B. WWF, Pro Natura), Bundesverwaltung, Parlamentsberatung und Medienhaus Beispiel: Ex-Geschäftsleiter WWF Schweiz → Direktor Umweltkommission → Experte SRF „Rundschau“ Kooperationen: PolitikerInnen, MediensprecherInnen, Mitglieder von Bundesämtern und Stiftungen, Netzwerk über Thinktanks und Expertenkomitees
⚠️ Infobox: Drehtür Deutschland/Österreich
Name: (typischer Karriereweg, viele Beispiele) Typisch: Wechsel von NGO-Kampagnenleitung (z. B. BUND, Greenpeace) zu Partei, Medien oder in politische Beratung Beispiel: Ex-Kampagnenleiter BUND → Berater im Bundestag → Medienkolumnist → Stiftungsexperte Kooperationen: Parteien, Medienhäuser, NGO-Lobbys, Stiftungsräte
Fazit: Was aussieht wie eine bunte Vielfalt der Meinungen, ist in Wahrheit eine geschlossene Gesellschaft mit immer denselben Gesichtern – und alle drehen sich im gleichen Filzkarussell, solange die Kassen klingeln.
Wer schützt uns vor den Weltverbesserern?
Die entscheidende Frage lautet: Wer schützt uns und unsere Demokratie eigentlich vor dem Ansturm der selbsternannten Weltverbesserer und NGO-Lobbyisten? Sicher nicht die Politik, die längst Teil des Problems ist, indem sie NGOs mit Fördergeldern und Aufträgen versorgt. Auch nicht die Parteien, die ihre Spin-Doktoren und Netzwerker inzwischen fest in den Vorständen und Beratungsgremien der NGO-Szene platziert haben. Und schon gar nicht die Medienhäuser von ARD über SRF bis ZDF, die sich von NGO-Studien und Aktivisten-„Experten“ den Sendeplan diktieren lassen und von Zwangsgebühren leben, als ob es noch kein Internet gäbe.
Die Lösung liegt nicht nur in neuen Regeln, sondern vor allem im Umdenken und in der klaren Wahrnehmung der Gefahren, die von der Macht der NGOs, Stiftungen und grossen Lobby-Vereine ausgehen. Ohne ein waches Volk, das erkennt, wie tief diese Strukturen bereits ins System eingedrungen sind, bleibt jede Reform reine Kosmetik.
Deshalb braucht es nebst den konkreten Lösungsansätzen ein neues Instrument: Die Einführung der Volks-Untersuchungs-Kommission (VUK) – ein unabhängiges Bürgergremium mit echter Kontrollfunktion. Nur solche Kommissionen können aufdecken, wer in Politik, Verwaltung und Medien hinter den Kulissen wirklich Einfluss nimmt und Geld verschiebt. Das Klagerecht für solche Fragen gehört ausschliesslich ins Volk, nicht in die Hände von Vereinen, Stiftungen und NGO-Lobbys.
Ein weiteres Muss: Öffentlich-rechtliche Medien wie ARD, SRF & Co. müssen entweder auf Zwangsgebühren verzichten und sich wie jeder andere Medienanbieter am Markt behaupten – oder aber, sofern sie weiter existieren, konsequent auch oppositionellen Strömungen und kritischen Stimmen zu besten Sendezeiten Zugang gewähren. Nur so entsteht wieder echte Vielfalt im öffentlichen Diskurs und die Übermacht der NGO-nahen Meinungsmacher wird gebrochen.
Fazit: Schützen kann uns letztlich nur ein aktives, mündiges Volk, das nicht länger alles glaubt, was gut gemeint, laut getrommelt und medial verpackt daherkommt. Echte Demokratie lebt davon, dass auch der Widerstand gegen den Mainstream sichtbar und hörbar bleibt – und dass Machtkontrolle nicht in den Händen derjenigen liegt, die sich selbst zu den Guten erklären.
Lösungsansätze: Wie wir uns von der NGO-Diktatur befreien
Nach all der Auflistung und Analyse bleibt die entscheidende Frage: Wie befreien wir uns als Gesellschaft aus dem Würgegriff der NGO-Republik? Zwischen PR-Kampagnen, millionenschweren Stiftungen und moralischer Dauerbespielung braucht es jetzt mehr als Empörung – es braucht einen klaren Plan. Die folgenden Lösungsansätze sind keine Wunschliste für Sonntagsreden, sondern das Handwerkszeug, um Demokratie und Selbstbestimmung zurückzuerobern. Wer glaubt, das gehe von selbst, kann weiter auf den NGO-Filz und System-Medien vertrauen – alle anderen finden hier das Werkzeug für den Ausstieg aus der Dauerbevormundung.
Hier die wichtigsten Lösungsansätze:
1. Absolutes Finanzierungsverbot durch den Staat
Kein Rappen, kein Cent, kein Euro: Keine Regierung, kein Ministerium und keine Behörde darf NGOs, Stiftungen oder Vereinen staatliche Gelder zukommen lassen. Wer politisch tätig ist, bekommt keinen Steuerfranken mehr – Punkt.
2. Strikte Trennung von Gemeinnützigkeit und Politik
Gemeinnützig dürfen nur Organisationen sein, die ausschliesslich im sozialen, kulturellen oder humanitären Bereich tätig sind – und zwar ohne jede politische Agenda. Wer sich politisch betätigt (Kampagnen, Abstimmungen, Referenden etc.), verliert sofort diesen Status und wird als Lobbyverein behandelt.
3. Transparenzpflicht für alle Geldflüsse
Jeder Franken, jede Spende, jeder Förderfranken muss offen gelegt werden. Ob Grossspende, Stiftungsgeld oder EU-Förderung – alles kommt auf den Tisch und ins öffentliche Register. Wer nicht transparent ist, verliert die Zulassung.
4. Klare strafrechtliche Konsequenzen
Wer als NGO, Stiftung oder Verein unerlaubt politisch aktiv wird oder Geld aus unerlaubten Quellen annimmt, muss mit harten Strafen rechnen – inklusive Schliessung der Organisation und persönlicher Haftung der Verantwortlichen.
5. Verbot der politischen Einflussnahme auf Meinungsbildung und Abstimmungen
NGOs, Vereine und Stiftungen dürfen keine politischen Kampagnen, Referenden, Abstimmungen oder Medienkampagnen zu politischen Themen anstossen, finanzieren oder begleiten. Die politische Willensbildung ist Sache der Bürger und des Parlaments, nicht privater Lobbyapparate.
6. Kein Klagerecht für NGOs, Vereine und Stiftungen in politischen oder gesellschaftlichen Fragen
Klagen zu politischen und gesellschaftlichen Themen sind ausschliesslich dem Volk, einzelnen Bürgern oder einer Volks-Untersuchungs-Kommission (VUK) vorbehalten. NGOs, Vereine und Stiftungen dürfen nicht mehr im Namen Dritter juristisch intervenieren und sich als „Anwälte des Volkes“ aufspielen.
7. Einführung und Stärkung echter Bürgergremien und unabhängiger Volks-Untersuchungs-Kommissionen (VUK)
Das Klagerecht, die politische Kontrolle und das Initiativrecht sollen bei echten Bürgergremien liegen, die unabhängig von Parteizugehörigkeit, NGOs und Lobbystrukturen arbeiten. Diese Gremien müssen öffentlich, transparent und demokratisch gewählt sein – und dürfen nicht von Stiftungen oder Vereinen gesteuert werden.
8. Aufwertung der direkten Demokratie und Volksentscheide
Mehr Mitsprache für das Volk, weniger Einfluss für „Bewegungen“, die sich selbst zum Sprachrohr erklären. Jede Entscheidung, die gesellschaftliche Tragweite hat, muss über Volksentscheide und direktdemokratische Instrumente laufen – nicht über NGO-„Experten“ und Kampagnenchefs.
Fazit:
Nur mit klaren Regeln, echter Transparenz und dem konsequenten Verbot von NGO-Macht in der Politik holen wir die Demokratie zurück zu denen, denen sie gehört: den Bürgerinnen und Bürgern. Der NGO-Spuk endet dort, wo wieder das Volk entscheidet – und nicht das Filznetzwerk der „gut gemeinten“ Meinungsmacher.
Schlussfazit: Demokratie deluxe – oder doch nur ein NGO-Bestellservice?
Am Ende bleibt der fade Beigeschmack einer Demokratie, in der nicht mehr das Volk entscheidet, sondern jene, die am besten PR machen und das grösste Spendennetzwerk bespielen. Die NGOs haben sich in den Maschinenraum der Macht eingeschlichen – ungewählt, unangreifbar, moralisch überhöht. Parteien, Medien und Regierungen reichen ihnen die Hand, solange die Kasse stimmt und die Empörung funktioniert.
Das Gute daran: Wer diesen Irrsinn durchschaut, muss nicht verzweifeln. Die Lösung ist unbequem, aber einfach: Laut bleiben. Kritisch sein. Keine Angst vor den moralischen Erpressungen der selbsternannten „Guten“. Echte Demokratie gibt es nur, wenn die Bürger sich nicht länger die Meinung vorschreiben lassen – von niemandem, auch nicht vom spendensatten NGO-Kollektiv mit Edelsiegel.
Wer Demokratie will, muss sie selbst machen – und nicht auf die Lieferung von der moralischen Söldnerarmee der Meinungsmacher warten.
In diesem Sinne: Zurück zur Selbstbestimmung, weg vom NGO-Bestellservice. Die Zukunft gehört den Unbequemen!